Wie kann Inklusion für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf im ersten Arbeitsmarkt gelingen? Dieser Beitrag zeigt praxisnahe Modelle, stufenweise Wege und konkrete Lösungsansätze für soziale Institutionen und Unternehmen.
Das bewährte Modell: Job Coach und Integrationsarbeitsplätze
Inklusion für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf ist eine zentrale Herausforderung – und gleichzeitig eine grosse Chance für soziale Innovation im Arbeitsmarkt. Gerade für diese Zielgruppe braucht es flexible Modelle, die individuelle Wege in Richtung Teilhabe ermöglichen.
Das Job Coach Modell hat sich in der beruflichen Inklusion als hilfreiches Instrument etabliert. Viele soziale Institutionen in der Schweiz verfügen über Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton, die es ihnen ermöglichen, sogenannte Integrationsarbeitsplätze anzubieten. Damit wird eine Zusammenarbeit mit Firmen aus dem ersten Arbeitsmarkt möglich.
In der Praxis bedeutet das: Menschen mit Behinderung bleiben bei der Institution angestellt, werden aber im Rahmen eines Personalverleihs stundenweise an Unternehmen ausgeliehen. Die Betreuung erfolgt durch eine Fachperson, den sogenannten Job Coach, der lose begleitet, aber nicht dauerhaft vor Ort ist.
Dieses Modell ist erfolgreich – allerdings vor allem für jene, die über ein hohes Mass an Selbstständigkeit und Stabilität verfügen. Doch genau hier liegt die Herausforderung.
Die 70 % dazwischen: Wer fällt durchs Raster?
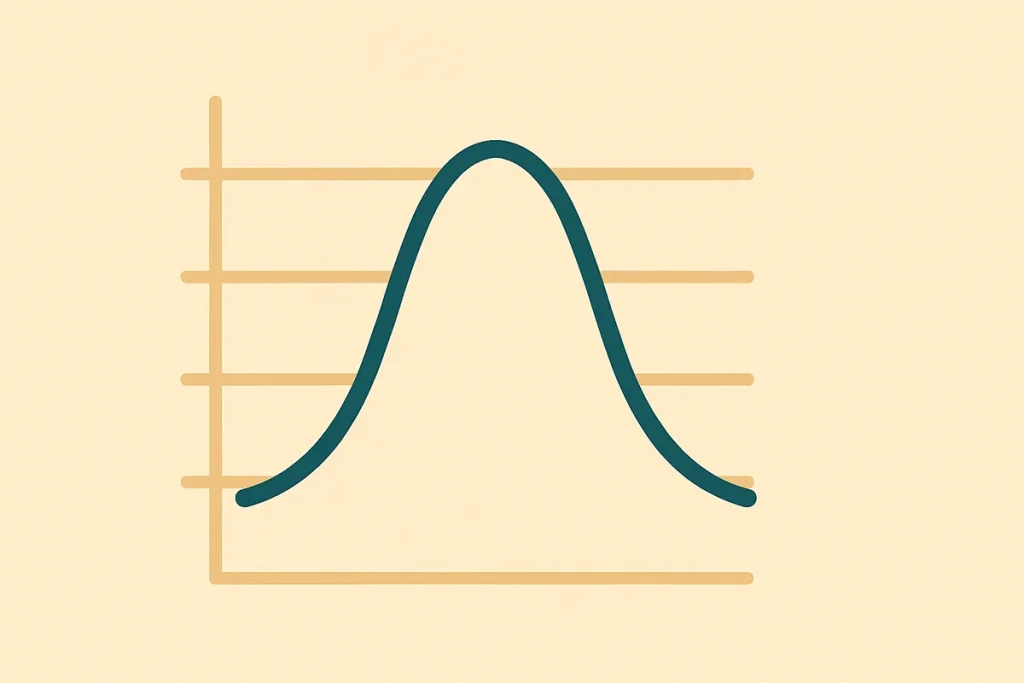
Inklusion im Arbeitsmarkt funktioniert für die leistungsstärksten Menschen mit Beeinträchtigung – etwa 15 % der Zielgruppe. Auf der anderen Seite gibt es ebenfalls ca. 15 %, die aufgrund schwerer Einschränkungen dauerhaft auf geschützte Rahmenbedingungen angewiesen sind.
Was aber ist mit der grossen Mehrheit von 70 %, die sich dazwischen befindet? Menschen, die mehr Unterstützung brauchen, als ein Job Coach bieten kann, aber gleichzeitig das Potenzial mitbringen, sich schrittweise in Richtung Inklusion zu entwickeln?
Neue Wege öffnen: flexible und stufenweise Modelle
Hier setzt die Arbeit von Inklusis GmbH an. Unser Ziel ist es, soziale Institutionen und Unternehmen dabei zu begleiten, auch Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf Perspektiven im ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen.
1. Arbeitsgruppen mit Betreuung im Betrieb
Eine Möglichkeit ist der Aufbau von Arbeitsgruppen, bestehend aus mehreren Menschen mit Beeinträchtigung, die von einer Fachperson vor Ort begleitet werden. Diese Gruppe arbeitet direkt in einem Betrieb mit klaren Aufgaben und gleichzeitiger beruflicher Teilhabe. Beispiele dafür siehe: Rotary Vortrag als erfolgreiche Praxisbeispiele.
2. Stunden- oder tageweise Einsätze
Eine weitere Form ist temporäre Einsätze: Die betroffene Person arbeitet normalerweise in einer geschützten Werkstatt, wird jedoch stunden- oder tageweise für einzelne Aufgaben oder Projekte in ein Unternehmen entsendet. Anschliessend kehrt sie in ihr gewohntes Umfeld zurück. Dieser Wechsel bietet die Chance, sich auszuprobieren und gleichzeitig Sicherheit im bisher gewohnten Umfeld zu bewahren.
3. Regionale Nähe als Schlüssel
Je näher die Institution und das Unternehmen geografisch beisammen liegen, desto leichter gelingt dieser stufenweise Wechsel. Kurze Wege ermöglichen eine flexible Gestaltung der Einsätze und erleichtern auch die Begleitung durch Fachpersonen.
4. Individuelle Kombinationen
Der Schlüssel liegt in einer individuellen Mischung aus geschützter Arbeit, inklusiven Einsätzen und gezieltem Training. So kann ein Mensch mit Unterstützungsbedarf z. B. 40 % in einem regionalen Betrieb mitarbeiten, 40 % in einer Werkstatt Stabilität finden und 20 % an einem Inklusionstraining teilnehmen. Diese flexible Staffelung ermöglicht Entwicklungsschritte ohne Überforderung.
Fazit
Inklusion ist kein «Entweder-oder», sondern ein Prozess, der individuell gestaltet und begleitet werden muss. Menschen mit mehr Unterstützungsbedarf dürfen dabei nicht vergessen gehen. Sie sind die zahlenmässig grösste Gruppe und daraus ergibt sich auch das grösste noch vorhandene Inklusionspotenzial. Durch neue Modelle, kreative Kombinationen und Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Unternehmen können auch sie Teilhabe im ersten Arbeitsmarkt erfahren. Es braucht Mut, Geduld und den Willen, neue Wege zu gehen. Aber es lohnt sich – für alle Beteiligten.
Gerne unterstütze ich Sie bei Ihrem Inklusionsprojekt. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf.







